


Die unterschiedlichen Begriffe von "Kultureller Vielfalt" (von Bernard Wicht)
Source : UNESCO
Mots-clés :
Im Folgenden werden die sieben wichtigsten Bedeutungsgehalte zusammengefasst (1).
1. Kulturelle Vielfalt – verstanden im Sinne von Multikulturalität. Obwohl dieser Terminus heute weit verbreitet ist und mit unterschiedlichen Bedeutungen verbunden wird, kann man sagen, dass Multikulturalität angelsächsischen Ursprungs ist; speziell bezogen auf die USA, impliziert er affirmatives Handeln von Minderheits-Kulturen (Nicht-Weissen, Nicht-Okzidentalen) gegenüber der herrschenden WASP-Kultur [White, Anglo-Saxon, Protestant]. In diesem Verständnis bedeutet Vielfalt eine Form der gesellschaftlichen Aufsplitterung und führt dazu, dass der soziale und nationale Zusammenhalt durch ein Nebeneinander von kulturellen Gemeinschaften, die durch kein Band miteinander verbunden sind, ersetzt wird.
2. Kulturelle Vielfalt – verstanden im Sinne kultureller Ausnahmestellung, bezogen auf das Verhältnis von Kultur und Kommerz. Dies bedeutet, dass kulturelle Güter und Leistungen nicht als Waren im üblichen Sinne betrachtet werden. Ihnen muss eine besonderer Status (eine Ausnahmestellung) im Rahmen der umfassenden Abmachungen zur Liberalisierung des Handels und der Wirtschaftsbeziehungen eingeräumt werden (General Agreement on Tariffs and Trade GATT; General Agreement on Trade in Services GATS; Welthandelsorganisation WTO; Multilaterales Investitions- Übereinkommen MIÜ etc.) Diese Ausnahmeregelung muss den Staaten vor allem erlauben, ihre eigenen Formen der Stärkung und Förderung von Kultur beizubehalten. Dies ist der Grundgedanke der Erklärung über die kulturelle Vielfalt, wie sie unlängst das Ministerkomitee des Europarates gebilligt hat.
3. Kulturelle Vielfalt – verstanden im Sinne kultureller Rechte. Hier geht es um den Bereich der Menschenrechte, um das Recht der Person auf ihre Identität (Sprache, Name etc.) und auf ihr Kulturerbe. Dadurch werden die Bereiche der politischen und sozialen Rechte insofern ergänzt, als Kultur zu einem Gebiet wird, das denselben Schutz verdient wie die anderen Bereiche. Im Gefolge des Wiener Gipfels (1993) hat der Europarat das Projekt eines Zusatzprotokolls zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten bezüglich der kulturellen Rechte
lanciert, ein Projekt, das mangels Übereinstimmung unter den Mitgliedsstaaten aber nicht zustande gekommen ist.
4. Kulturelle Vielfalt – verstanden im Sinne des Schutzes der Minderheiten sowie der Regional- und Minderheitensprachen. Dabei handelt es sich um eine ähnliche Frage wie bei den kulturellen Rechten, doch hat sie ihrerseits zwei wichtige Dokumente des Europarates bewirkt, die Rahmenkonvention zum Schutze der nationalen
Minderheiten und die Europäische Charta der Regional- und Minderheitssprachen.
5. Kulturelle Vielfalt – verstanden im Sinne der Beziehung zwischen Kultur und Entwicklung. Dies ist der Begriff, der seitens der UNESCO im Pérez de Cuellar-Report, „Notre diversité créatrice“, definiert worden ist. Diesem Ansatz zufolge sind Bewahrung und Förderung der unterschiedlichen Kulturen auf der Welt die absolut notwendige Vorbedingung für eine harmonische und nachhaltige Entwicklung der Gesellschaften, sowohl auf der politischen und sozialen als auch auf der wirtschaftlichen Ebene.
6. Kulturelle Vielfalt – verstanden im Sinne friedlichen Zusammenlebens und wechselseitigen Verständnisses zwischen Gruppen und Gemeinschaften, die im selben Lande oder in derselben Gesellschaft leben, aber nicht derselben Kultur (Sprache, Religion etc.) angehören. Dies ist der schweizerische Ansatz, demzufolge der Begriff Vielfalt vor allem Harmonie und Einvernehmen unterschiedlicher Komponenten in ein und demselben Ganzen bedeutet. Aus dieser Sicht besteht das Ideal nicht darin, die Rechte der einen in Bezug auf die anderen zu betonen, sondern Austausch und Dialog anzustreben, die zu wechselseitigem Verstehen und friedlichem Miteinander führen. Diese Konzeption hat teilweise Eingang in die Querschnitt-Studie des Europarates über den Umgang mit kultureller Vielfalt gefunden.
7. Kulturelle Vielfalt – verstanden im Sinne von Kulturpolitik. Hier liegt das Prinzip zugrunde, dass die Kulturpolitik eines Landes Unterschiede in den Kulturen, die im Lande leben, widerspiegeln sollte. Daher darf sich die Kulturpolitik nicht damit begnügen, das [Selbst-]Bild der dominierenden Schichten einer Gesellschaft zu reflektieren, sie muss vielmehr darüber wachen, dass das Kunstschaffen aus verschiedenen Sparten (Ausstellung, Theater, Museen, Kino, Musik etc.) die Gesamtheit der kulturellen Vorstellungen einer Bevölkerung widerspiegelt. Diese Position vertritt man vor allem in Kanada, und sie kommt auch in der Querschnittstudie über den Umgang mit der kulturellen Vielfalt zur Geltung. Aufs Ganze gesehen, kann man sagen, dass in den meisten Fällen der Begriff der kulturellen Vielfalt auf „Gesellschaft“ bezogen wird, das heisst auf ein vorhandenes Zusammenleben mehrerer Kulturen in ein und demselben Lande. Dieses Zusammenleben kann zum Ausdruck gelangen durch affirmatives Handeln (Multikulturalität), durch die Garantie von Rechten (kulturelle Rechte, Schutz der Minderheiten und der Sprachen), als Ausgangsbedingung für nachhaltige Entwicklung oder durch das Bestreben nach Dialog und wechselseitigem Verstehen (wie es für die Schweiz zutrifft). Dagegen versteht sich kulturelle Vielfalt – besonders in Punkt 7 und 2 - vor allem als Ausdruck für „schöpferische Leistung“ und „Kreativität“: sie ist die Vielfalt künstlerischen Schaffens gegenüber monolithischer kultureller Selbstdarstellung der herrschenden sozialen Schichten, beziehungsweise die Bewahrung der Vielfalt von kulturellen Gütern und Leistungen gegenüber den Risiken einer Vereinheitlichung des Marktes: Es ist eindeutig diese letzte, auf Kommerz bezogene Deutung, die dem Begriff der kulturellen Vielfalt international zur Anerkennung verholfen hat.
Anmerkungen:
(1) Zum besseren Verständnis der Unterschiede wurde die Darstellung bewusst vereinfacht und schematisiert. B.W.



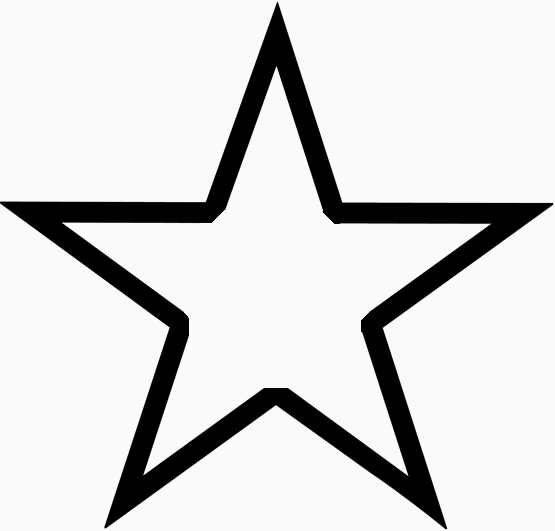
 Quand la neuroscience rencontre l’IA : à quoi ressemble l’avenir de l’apprentissage ?
Quand la neuroscience rencontre l’IA : à quoi ressemble l’avenir de l’apprentissage ?  À l'avant-garde d'un mouvement mondial pour la conservation : Rapport annuel 2018 du Programme marin du patrimoine mondial
À l'avant-garde d'un mouvement mondial pour la conservation : Rapport annuel 2018 du Programme marin du patrimoine mondial La pauvreté mondiale pourrait être réduite de moitié si tous les adultes achevaient leurs études secondaires
La pauvreté mondiale pourrait être réduite de moitié si tous les adultes achevaient leurs études secondaires L’UNESCO dresse un premier inventaire de l’état des sciences océaniques dans le monde
L’UNESCO dresse un premier inventaire de l’état des sciences océaniques dans le monde Nombre de biens du patrimoine mondial par État partie
Nombre de biens du patrimoine mondial par État partie  "Les arts sont complémentaires d'une presse libre" : entretien avec Deeyah Khan, Ambassadrice de bonne volonté
"Les arts sont complémentaires d'une presse libre" : entretien avec Deeyah Khan, Ambassadrice de bonne volonté Les eaux usées : nouvel or noir ?
Les eaux usées : nouvel or noir ? Robert Badinter sur l'antisémitisme : tirer les enseignements de l'histoire
Robert Badinter sur l'antisémitisme : tirer les enseignements de l'histoire Edgar Morin : enseigner la complexité
Edgar Morin : enseigner la complexité Les manuels scolaires dépassés mettent en péril le développement durable
Les manuels scolaires dépassés mettent en péril le développement durable Patrimoine marin en Haute mer. Une idée qui fait son chemin
Patrimoine marin en Haute mer. Une idée qui fait son chemin La migration est une chance pas une menace pour le développement durable
La migration est une chance pas une menace pour le développement durable Le Comité du patrimoine mondial s’est ouvert à Istanbul
Le Comité du patrimoine mondial s’est ouvert à Istanbul Acidification des océans
Acidification des océans eAtlas de l'UNESCO des inégalités entre les sexes dans l'éducation
eAtlas de l'UNESCO des inégalités entre les sexes dans l'éducation L'eau et l'emploi, fait et chiffres
L'eau et l'emploi, fait et chiffres L'eau et l'emploi
L'eau et l'emploi François Taddéi : nous avons dans nos poches plus de puissance de calcul que n’en avait la NASA pour aller sur la Lune
François Taddéi : nous avons dans nos poches plus de puissance de calcul que n’en avait la NASA pour aller sur la Lune La parité entre les sexes dans l’éducation
La parité entre les sexes dans l’éducation Les filles sont deux fois plus nombreuses que les garçons à ne jamais commencer l’école
Les filles sont deux fois plus nombreuses que les garçons à ne jamais commencer l’école Près de la moitié de la population mondiale n’a pas accès à l’éducation dans une langue qu’elle comprend
Près de la moitié de la population mondiale n’a pas accès à l’éducation dans une langue qu’elle comprend L’UNESCO et la Commission européenne s’unissent pour promouvoir les routes culturelles du développement durable
L’UNESCO et la Commission européenne s’unissent pour promouvoir les routes culturelles du développement durable Rapport de l'UNESCO sur le racisme et la discrimination dans le football présenté à l’Association européenne des clubs
Rapport de l'UNESCO sur le racisme et la discrimination dans le football présenté à l’Association européenne des clubs Journée mondiale de la radio. La radio, média clé en situation d’urgence et de catastrophe
Journée mondiale de la radio. La radio, média clé en situation d’urgence et de catastrophe Rapport de l' UNESCO sur la science, vers 2030
Rapport de l' UNESCO sur la science, vers 2030 Une nouvelle stratégie renforce la protection du patrimoine en danger
Une nouvelle stratégie renforce la protection du patrimoine en danger 4e Congrès mondial des réserves de biosphère
4e Congrès mondial des réserves de biosphère L’UNESCO présente un nouveau modèle de financement pour favoriser l’accès aux manuels scolaires
L’UNESCO présente un nouveau modèle de financement pour favoriser l’accès aux manuels scolaires Lancement d’une initiative mondiale pour lutter contre les destructions et le trafic de biens culturels par les terroristes et le crime organisé
Lancement d’une initiative mondiale pour lutter contre les destructions et le trafic de biens culturels par les terroristes et le crime organisé La célébration de la Journée internationale du Jazz en RDC
La célébration de la Journée internationale du Jazz en RDC  Le journaliste syrien Mazen Darwish lauréat du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano
Le journaliste syrien Mazen Darwish lauréat du Prix mondial de la liberté de la presse UNESCO/Guillermo Cano Lancement du Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2015
Lancement du Rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2015 Lancement du Rapport mondial de l’eau à New Delhi
Lancement du Rapport mondial de l’eau à New Delhi Les violences basées sur le genre à l’école et alentour empêchent des millions d’enfants dans le monde de réaliser pleinement leur potentiel scolaire
Les violences basées sur le genre à l’école et alentour empêchent des millions d’enfants dans le monde de réaliser pleinement leur potentiel scolaire L’éducation physique permet de vivre mieux et plus longtemps
L’éducation physique permet de vivre mieux et plus longtemps Dix ans après le tsunami de 2004, l’océan Indien mieux armé pour faire face à une catastrophe
Dix ans après le tsunami de 2004, l’océan Indien mieux armé pour faire face à une catastrophe « Culture, créativité et développement durable ». Déclaration adoptée lors du troisième Forum mondial de l’UNESCO
« Culture, créativité et développement durable ». Déclaration adoptée lors du troisième Forum mondial de l’UNESCO Irina Bokova félicite la professeure Maryam Mirzakhani, première mathématicienne à recevoir la médaille Fields
Irina Bokova félicite la professeure Maryam Mirzakhani, première mathématicienne à recevoir la médaille Fields Archival study traces the history of a wealthy Venetian family
Archival study traces the history of a wealthy Venetian family The Right To Education - Law and Policy Review Guidelines
The Right To Education - Law and Policy Review Guidelines Journée mondiale d’action pour la jeunesse des Petits Etats Insulaires en Développement
Journée mondiale d’action pour la jeunesse des Petits Etats Insulaires en Développement Le CERN et l’UNESCO : 60 ans de science pour la paix
Le CERN et l’UNESCO : 60 ans de science pour la paix L’aide à l’éducation a baissé de 10 % depuis 2010
L’aide à l’éducation a baissé de 10 % depuis 2010 Avec la ratification des Bahamas, toute la région Amérique Latine et Caraïbes a désormais ratifié la Convention du patrimoine mondial
Avec la ratification des Bahamas, toute la région Amérique Latine et Caraïbes a désormais ratifié la Convention du patrimoine mondial Histoire de l'UNESCO
Histoire de l'UNESCO Journée Mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement
Journée Mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement Message vidéo de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse
Message vidéo de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse L’éducation à la citoyenneté mondiale : Préparer les apprenants à relever les défis du XXIe siècle
L’éducation à la citoyenneté mondiale : Préparer les apprenants à relever les défis du XXIe siècle Vidéo institutionnelle du Fonds international pour la diversité culturelle
Vidéo institutionnelle du Fonds international pour la diversité culturelle Le bureau de l’UNESCO à Rabat publie deux nouvelles études sur la liberté d’information
Le bureau de l’UNESCO à Rabat publie deux nouvelles études sur la liberté d’information Élimination de la discrimination raciale - 21 mars
Élimination de la discrimination raciale - 21 mars À ressources critiques, réflexion critique
À ressources critiques, réflexion critique Helping science respond to society, through open data
Helping science respond to society, through open data Journée mondiale de la justice sociale 2014
Journée mondiale de la justice sociale 2014 La crise mondiale de l’apprentissage coûte 129 milliards de dollars par an
La crise mondiale de l’apprentissage coûte 129 milliards de dollars par an Enseigner et apprendre: Atteindre la qualité pour tous
Enseigner et apprendre: Atteindre la qualité pour tous L’UNESCO commémore la Journée internationale en mémoire des victimes de l’Holocauste
L’UNESCO commémore la Journée internationale en mémoire des victimes de l’Holocauste Journée de commémoration de l'Holocauste
Journée de commémoration de l'Holocauste Patrimoine Mondial
Patrimoine Mondial Lancement de l’Année internationale de la cristallographie à l’UNESCO
Lancement de l’Année internationale de la cristallographie à l’UNESCO Autonomisation des femmes rurales en Jordanie et conservation du patrimoine pour le développement durable
Autonomisation des femmes rurales en Jordanie et conservation du patrimoine pour le développement durable UNESCO commemorates International Holocaust Remembrance Day
UNESCO commemorates International Holocaust Remembrance Day L’éducation au changement climatique au service du développement durable
L’éducation au changement climatique au service du développement durable Puente Q´eswachaka es incorporado a la lista de Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad de la UNESCO
Puente Q´eswachaka es incorporado a la lista de Patrimonio Cultural inmaterial de la Humanidad de la UNESCO Voyage dans la société numérique
Voyage dans la société numérique L’UNESCO et l’ASEAN signent un accord de coopération
L’UNESCO et l’ASEAN signent un accord de coopération Renforcer la gouvernance de la culture pour créer des opportunités de développement
Renforcer la gouvernance de la culture pour créer des opportunités de développement Forum mondial des droits Humains (Brasilia 2013)
Forum mondial des droits Humains (Brasilia 2013) Les jeunes aujourd’hui – Il est temps d’agir
Les jeunes aujourd’hui – Il est temps d’agir Des découvertes archéologiques au Népal confirment des dates plus anciennes pour la vie de Bouddha
Des découvertes archéologiques au Népal confirment des dates plus anciennes pour la vie de Bouddha Rapport mondial sur les sciences sociales 2013 - Changements environnementaux globaux
Rapport mondial sur les sciences sociales 2013 - Changements environnementaux globaux Rapport sur l'économie créative des Nations Unies 2013, Édition spéciale
Rapport sur l'économie créative des Nations Unies 2013, Édition spéciale Journée mondiale de la philosophie 2013 : "Des sociétés inclusives, une planète durable"
Journée mondiale de la philosophie 2013 : "Des sociétés inclusives, une planète durable" L’acidification des océans s’effectue à un rythme sans précédent
L’acidification des océans s’effectue à un rythme sans précédent 8e Forum des jeunes de l’UNESCO : Laissez la jeunesse prendre sa place !
8e Forum des jeunes de l’UNESCO : Laissez la jeunesse prendre sa place ! L’UNESCO renforce sa coopération avec les pays de la zone Caraïbes
L’UNESCO renforce sa coopération avec les pays de la zone Caraïbes Patrimoine culturel immatériel : Une force pour le développement durable
Patrimoine culturel immatériel : Une force pour le développement durable Gérer notre patrimoine mondial marin : les joyaux de l'Océan
Gérer notre patrimoine mondial marin : les joyaux de l'Océan UNESCO-European Union: working together for change
UNESCO-European Union: working together for change Le droit à l'éducation des filles est la lutte pour un monde meilleur
Le droit à l'éducation des filles est la lutte pour un monde meilleur L’éducation influence le développement selon de nouvelles données de l’UNESCO
L’éducation influence le développement selon de nouvelles données de l’UNESCO Plan d’action de l’UNESCO pour la priorité égalité des genres 2014-2021
Plan d’action de l’UNESCO pour la priorité égalité des genres 2014-2021 Conférence internationale de haut niveau sur la coopération dans le domaine de l’eau
Conférence internationale de haut niveau sur la coopération dans le domaine de l’eau Journée internationale de la jeunesse 2013 : « Migration et jeunesse : aller de l'avant pour le développement »
Journée internationale de la jeunesse 2013 : « Migration et jeunesse : aller de l'avant pour le développement » Les enfants luttent encore pour aller à l’école
Les enfants luttent encore pour aller à l’école L’UNESCO, l’UNICEF et l'UNFPA donnent la parole aux jeunes des petits États insulaires sur le futur qu’ils veulent
L’UNESCO, l’UNICEF et l'UNFPA donnent la parole aux jeunes des petits États insulaires sur le futur qu’ils veulent « La mondialisation rapide de l'économie et du progrès scientifique soulève de nouveaux défis » - entretien avec M. L'udovít Molnár, Président de la Commission slovaque pour l'UNESCO
« La mondialisation rapide de l'économie et du progrès scientifique soulève de nouveaux défis » - entretien avec M. L'udovít Molnár, Président de la Commission slovaque pour l'UNESCO La Déclaration de Hangzhou annonce la prochaine ère de développement humain
La Déclaration de Hangzhou annonce la prochaine ère de développement humain Journée mondiale de la radio
Journée mondiale de la radio 2013 International Year of Water Cooperation
2013 International Year of Water Cooperation  Aller de l’avant : l’UNESCO en 2013
Aller de l’avant : l’UNESCO en 2013 Irina Bokova : « Il ne peut pas y avoir de développement durable sans gestion durable de l’eau. »
Irina Bokova : « Il ne peut pas y avoir de développement durable sans gestion durable de l’eau. » Global Flow of Tertiary-Level Students
Global Flow of Tertiary-Level Students  Journée mondiale du patrimoine audiovisuel : « La mémoire du patrimoine audiovisuel ? le temps est compté » (27 octobre 2012)
Journée mondiale du patrimoine audiovisuel : « La mémoire du patrimoine audiovisuel ? le temps est compté » (27 octobre 2012) Rapport 2012. Jeunes et compétences : l’éducation au travail
Rapport 2012. Jeunes et compétences : l’éducation au travail Irina Bokova se joint au Secrétaire général de l’ONU pour le lancement de sa nouvelle initiative mondiale « L’éducation avant tout »
Irina Bokova se joint au Secrétaire général de l’ONU pour le lancement de sa nouvelle initiative mondiale « L’éducation avant tout » Mémoire du monde : conserver des documents pour lutter contre l’amnésie collective
Mémoire du monde : conserver des documents pour lutter contre l’amnésie collective Journée internationale de l’alphabétisation 2012. L’alphabétisation et la paix
Journée internationale de l’alphabétisation 2012. L’alphabétisation et la paix Séminaire sur l’Année Internationale de la Coopération dans le domaine de l’Eau et la Journée mondiale de l’eau 2013 (27 août 2012, Stockholm - Suède)
Séminaire sur l’Année Internationale de la Coopération dans le domaine de l’Eau et la Journée mondiale de l’eau 2013 (27 août 2012, Stockholm - Suède) L’éducation pour tous commence par des ressources éducatives libres
L’éducation pour tous commence par des ressources éducatives libres Avant-première mondiale du documentaire "La guerre contre le dopage"
Avant-première mondiale du documentaire "La guerre contre le dopage" Journée mondiale de l’océan
Journée mondiale de l’océan Les grands fonds : dernière frontière ?
Les grands fonds : dernière frontière ? Semaine internationale de l'éducation artistique 2012
Semaine internationale de l'éducation artistique 2012 La Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et pour le développement
La Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et pour le développement L’éducation à l’éthique : un enjeu de coopération internationale
L’éducation à l’éthique : un enjeu de coopération internationale Apprendre dans un monde pauvre en livres et riche en mobiles
Apprendre dans un monde pauvre en livres et riche en mobiles Journée mondiale de la liberté de la presse 2012
Journée mondiale de la liberté de la presse 2012 La mondialisation de l’éducation à l’Holocauste
La mondialisation de l’éducation à l’Holocauste Construire la paix au rythme du jazz - Journée internationale du jazz
Construire la paix au rythme du jazz - Journée internationale du jazz Madiodio Niasse sur les risques liés à l’acquisition des terres, à grande échelle, par des investisseurs étrangers
Madiodio Niasse sur les risques liés à l’acquisition des terres, à grande échelle, par des investisseurs étrangers Forum UNESCO du Futur : “ 2050 : Quel avenir mondial pour l’eau ? ” (12 avril 2012, Paris - France)
Forum UNESCO du Futur : “ 2050 : Quel avenir mondial pour l’eau ? ” (12 avril 2012, Paris - France) Journée mondiale du livre et du droit d'auteur
Journée mondiale du livre et du droit d'auteur Journée Internationale du Jazz
Journée Internationale du Jazz Le confucianisme et le nouvel humanisme au cœur du Forum Paris-Nishan (16 avril 2012, Paris - France)
Le confucianisme et le nouvel humanisme au cœur du Forum Paris-Nishan (16 avril 2012, Paris - France) Des sites du patrimoine mondial participent à Earth Hour
Des sites du patrimoine mondial participent à Earth Hour Le Forum Netexplo 2012 (15-16 mars 2012, Paris - France)
Le Forum Netexplo 2012 (15-16 mars 2012, Paris - France) Les ressources mondiales en eau menacées par la hausse de la demande et le changement climatique d’après le Rapport des Nations Unies sur l’évaluation des ressources en eau
Les ressources mondiales en eau menacées par la hausse de la demande et le changement climatique d’après le Rapport des Nations Unies sur l’évaluation des ressources en eau Les Universités se mobilisent pour des sociétés vertes: l’initiative de l’enseignement supérieur pour le développement durable de Rio + 20
Les Universités se mobilisent pour des sociétés vertes: l’initiative de l’enseignement supérieur pour le développement durable de Rio + 20 Journée internationale de la femme 2012 : l’UNESCO agit en faveur des femmes de milieu rural
Journée internationale de la femme 2012 : l’UNESCO agit en faveur des femmes de milieu rural L’éducation pour le développement durable préserve la diversité linguistique et culturelle
L’éducation pour le développement durable préserve la diversité linguistique et culturelle Le journalisme dans un monde numérique
Le journalisme dans un monde numérique La mesure du développement - comment science et politique se conjuguent
La mesure du développement - comment science et politique se conjuguent Des économies vertes aux sociétés vertes (4-6 juin 2012, Rio de Janeiro - Brésil)
Des économies vertes aux sociétés vertes (4-6 juin 2012, Rio de Janeiro - Brésil) Forum : « Le printemps arabe – un an après – perspectives égyptiennes » (24 janvier 2012, Paris - France)
Forum : « Le printemps arabe – un an après – perspectives égyptiennes » (24 janvier 2012, Paris - France) La Communication et l’information en 2012
La Communication et l’information en 2012 Les jeunes créent des messages forts sur le changement climatique
Les jeunes créent des messages forts sur le changement climatique Admission de la Palestine comme Etat membre de l’UNESCO
Admission de la Palestine comme Etat membre de l’UNESCO Le développement durable et culture de la paix au cœur de la 36e session de la Conférence générale de l'UNESCO
Le développement durable et culture de la paix au cœur de la 36e session de la Conférence générale de l'UNESCO Comment les jeunes conduisent le changement - 7e Forum des jeunes de l’UNESCO 2011 (17 - 20 octobre 2011, Paris - France)
Comment les jeunes conduisent le changement - 7e Forum des jeunes de l’UNESCO 2011 (17 - 20 octobre 2011, Paris - France) L’UNESCO dévoile sa nouvelle stratégie sur le VIH et le SIDA
L’UNESCO dévoile sa nouvelle stratégie sur le VIH et le SIDA Meurtres de journalistes : les Nations Unies se mobilisent contre l’impunité
Meurtres de journalistes : les Nations Unies se mobilisent contre l’impunité 8 septembre, Journée internationale de l’alphabétisation :
8 septembre, Journée internationale de l’alphabétisation : 793 millions d’adultes ne savent ni lire ni écrire
 Forum des politiques éducatives de l’IIPE 2011 : l’égalité entre les sexes dans l’éducation : voir au-delà de la parité (3-4 octobre 2011, Paris - France)
Forum des politiques éducatives de l’IIPE 2011 : l’égalité entre les sexes dans l’éducation : voir au-delà de la parité (3-4 octobre 2011, Paris - France) Conférence : " 15e Conférence internationale des femmes ingénieurs et
Conférence : " 15e Conférence internationale des femmes ingénieurs et scientifiques (ICWES) : Leadership, Innovation, Durabilité "
(19 - 22 juillet 2011, Adelaïde - Australie)
 L’UNESCO s’implique dans une alliance visant à protéger les systèmes éducatifs contre les attaques
L’UNESCO s’implique dans une alliance visant à protéger les systèmes éducatifs contre les attaques Table ronde : « Démocratie et renouveau dans le monde arabe : l’UNESCO accompagne les transitions vers la démocratie » (21 juin 2011, Paris - France)
Table ronde : « Démocratie et renouveau dans le monde arabe : l’UNESCO accompagne les transitions vers la démocratie » (21 juin 2011, Paris - France) La nouveau Rapport de la Commission pour le développement digital se penche sur la fourniture d’une connection à haut débit aux communautés les plus pauvres
La nouveau Rapport de la Commission pour le développement digital se penche sur la fourniture d’une connection à haut débit aux communautés les plus pauvres Congrès : « La recherche en éducation dans le monde: Ou en sommes-nous ? » Thèmes, méthodologies et politiques de recherche (Paris, Siege de l'UNESCO, 14-17 juin 2011)
Congrès : « La recherche en éducation dans le monde: Ou en sommes-nous ? » Thèmes, méthodologies et politiques de recherche (Paris, Siege de l'UNESCO, 14-17 juin 2011) L’UNESCO va lancer un partenariat mondial en faveur de l’éducation des filles et des femmes
L’UNESCO va lancer un partenariat mondial en faveur de l’éducation des filles et des femmes La Directrice générale appelle au respect de la liberté d’expression partout dans le monde
La Directrice générale appelle au respect de la liberté d’expression partout dans le monde 18 avril – Journée internationale des monuments et sites 2011 : Patrimoine culturel de l’eau
18 avril – Journée internationale des monuments et sites 2011 : Patrimoine culturel de l’eau Message de la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. « L'eau pour les villes: répondre au défi urbain »
Message de la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova, à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau. « L'eau pour les villes: répondre au défi urbain » Message de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée internationale de la femme
Message de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée internationale de la femme Les conflits privent d’avenir 28 millions d'enfants, selon un rapport de l'UNESCO
Les conflits privent d’avenir 28 millions d'enfants, selon un rapport de l'UNESCO Message de la Directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle
Message de la Directrice générale de l'UNESCO, Mme Irina Bokova, à l’occasion de la Journée internationale de la langue maternelle Projet de livre de l’UNESCO pour 2011 sur les migrations, l’environnement et le changement climatique
Projet de livre de l’UNESCO pour 2011 sur les migrations, l’environnement et le changement climatique Fast Car : rouler en toute sécurité autour du monde
Fast Car : rouler en toute sécurité autour du monde 65º aniversario de la adopción de la Constitución de la UNESCO - 65 acciones de la UNESCO en beneficio de los países del mundo
65º aniversario de la adopción de la Constitución de la UNESCO - 65 acciones de la UNESCO en beneficio de los países del mundo 50 years of combating discrimination in education
50 years of combating discrimination in education Climate change education for sustainable development: the UNESCO climate change initiative
Climate change education for sustainable development: the UNESCO climate change initiative 18 novembre : célébration de la Journée mondiale de la philosophie 2010
18 novembre : célébration de la Journée mondiale de la philosophie 2010 La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité s’enrichit de 46 nouveaux éléments
La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité s’enrichit de 46 nouveaux éléments Recherche et développement : les Etats-Unis, l’Europe et le Japon de plus en plus concurrencés par les pays émergents selon un rapport de l’UNESCO
Recherche et développement : les Etats-Unis, l’Europe et le Japon de plus en plus concurrencés par les pays émergents selon un rapport de l’UNESCO La pénurie d’ingénieurs est une menace pour le développement, selon le premier rapport de l’UNESCO sur le sujet
La pénurie d’ingénieurs est une menace pour le développement, selon le premier rapport de l’UNESCO sur le sujet "Le pouvoir de la culture pour le développement" - brochure publiée par l'UNESCO
"Le pouvoir de la culture pour le développement" - brochure publiée par l'UNESCO Moins de 40 % des pays ont atteint la parité filles-garçons dans l'éducation, selon un rapport de l'UNESCO
Moins de 40 % des pays ont atteint la parité filles-garçons dans l'éducation, selon un rapport de l'UNESCO Journée internationale de l’alphabétisation (8 septembre) L’UNESCO lance le Réseau des savoirs et innovations au service de l’alphabétisation
Journée internationale de l’alphabétisation (8 septembre) L’UNESCO lance le Réseau des savoirs et innovations au service de l’alphabétisation Vient de paraître : Kit Jeune Diversités, le jeu de la créativité
Vient de paraître : Kit Jeune Diversités, le jeu de la créativité Message de la Directrice générale de l’Unesco Irina Bokova, à l’occasion de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition
Message de la Directrice générale de l’Unesco Irina Bokova, à l’occasion de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition Le Comité du patrimoine mondial inscrit un total de 21 nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
Le Comité du patrimoine mondial inscrit un total de 21 nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO Le Comité du patrimoine mondial se réunit à Brasilia pour inscrire de nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
Le Comité du patrimoine mondial se réunit à Brasilia pour inscrire de nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO Sciences sociales : le Rapport mondial 2010 constate la progression des pays émergents
Sciences sociales : le Rapport mondial 2010 constate la progression des pays émergents Résumé du Symposium « La gestion des risques dans le financement de la culture » (16-17 avril 2010 à Paris)
Résumé du Symposium « La gestion des risques dans le financement de la culture » (16-17 avril 2010 à Paris) Message de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement le 21 mai 2010
Message de Mme Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement le 21 mai 2010 3ème Festival International de la Diversité (Du 17 au 27 mai 2010 )
3ème Festival International de la Diversité (Du 17 au 27 mai 2010 ) "Libertad de expresión" : le Bureau de l’UNESCO à Quito publie une BD sur la liberté d’expression
"Libertad de expresión" : le Bureau de l’UNESCO à Quito publie une BD sur la liberté d’expression Rapport du Symposium "Culture et développement : une réponse aux défis du futur ?" (qui s'est tenu en octobre 2009 à Paris)
Rapport du Symposium "Culture et développement : une réponse aux défis du futur ?" (qui s'est tenu en octobre 2009 à Paris) 2ème Conférence mondiale sur le dialogue interreligieux et intercivilisationnel (6-9 mai 2010, Ohrid - ex-République yougoslave de Macédoine)
2ème Conférence mondiale sur le dialogue interreligieux et intercivilisationnel (6-9 mai 2010, Ohrid - ex-République yougoslave de Macédoine) L’enjeu éthique du changement climatique
L’enjeu éthique du changement climatique Gilles Bœuf, Président du Muséum national d’histoire naturelle (France) : «Il faut imposer le versement de droits pour puiser dans les ressources »
Gilles Bœuf, Président du Muséum national d’histoire naturelle (France) : «Il faut imposer le versement de droits pour puiser dans les ressources » La réunion d’experts à Paris revoit le concept de société du savoir
La réunion d’experts à Paris revoit le concept de société du savoir Journée internationale de la femme: Entretien avec Mme Irina Bokova, première femme élue au poste de Directrice générale de l’UNESCO
Journée internationale de la femme: Entretien avec Mme Irina Bokova, première femme élue au poste de Directrice générale de l’UNESCO Le rapport mondial 2009 du Programme Information pour tous (PIPT) disponible en ligne
Le rapport mondial 2009 du Programme Information pour tous (PIPT) disponible en ligne Création d’un institut de recherche sur l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest
Création d’un institut de recherche sur l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest La Directrice générale de l’UNESCO lance l’Année internationale du rapprochement des cultures
La Directrice générale de l’UNESCO lance l’Année internationale du rapprochement des cultures Le défi mondial de la biodiversité
Le défi mondial de la biodiversité La crise financière menace de faire reculer l’éducation dans le monde, selon un rapport de l’UNESCO
La crise financière menace de faire reculer l’éducation dans le monde, selon un rapport de l’UNESCO Migration and Human Rights. The United Nations Convention on Migrant Workers' Rights / Édité en anglais par Paul de Guchteneire, UNESCO, Paris ; Antoine Pecoud, UNESCO, Paris ; et Ryszard Cholewinski, Organisation internationale pour les migrations, Genève
Migration and Human Rights. The United Nations Convention on Migrant Workers' Rights / Édité en anglais par Paul de Guchteneire, UNESCO, Paris ; Antoine Pecoud, UNESCO, Paris ; et Ryszard Cholewinski, Organisation internationale pour les migrations, Genève L'Unesco : la mieux placée pour apporter des réponses à la globalisation
L'Unesco : la mieux placée pour apporter des réponses à la globalisation UNESCO and ICANN sign partnership agreement to promote linguistic diversity on internet
UNESCO and ICANN sign partnership agreement to promote linguistic diversity on internet L’éducation en vue du développement durable est déterminante dans la lutte contre le changement climatique
L’éducation en vue du développement durable est déterminante dans la lutte contre le changement climatique Google et l’UNESCO annoncent un accord qui permettra des visites virtuelles de plusieurs sites du patrimoine mondial
Google et l’UNESCO annoncent un accord qui permettra des visites virtuelles de plusieurs sites du patrimoine mondial L’UNESCO publie une brochure sur le suivi du Sommet mondial sur la société de l’information
L’UNESCO publie une brochure sur le suivi du Sommet mondial sur la société de l’information L'UNESCO publie une brochure sur le droit humain à l'eau
L'UNESCO publie une brochure sur le droit humain à l'eau Trop de murs restent debout, déclare la Directrice générale de l’UNESCO élue
Trop de murs restent debout, déclare la Directrice générale de l’UNESCO élue La mort de Claude Lévi-Strauss est une perte pour l’humanité toute entière, déclare le Directeur général de l’UNESCO
La mort de Claude Lévi-Strauss est une perte pour l’humanité toute entière, déclare le Directeur général de l’UNESCO "Mémoires environnementales" – une série de biographies de citoyens du monde entier
"Mémoires environnementales" – une série de biographies de citoyens du monde entier La science doit occuper une vraie place prioritaire
La science doit occuper une vraie place prioritaire Il est urgent d’investir dans la diversité culturelle et le dialogue, selon un nouveau rapport de l’UNESCO
Il est urgent d’investir dans la diversité culturelle et le dialogue, selon un nouveau rapport de l’UNESCO Projet de livre de l’UNESCO pour 2010 sur les migrations, l’environnement et le changement climatique
Projet de livre de l’UNESCO pour 2010 sur les migrations, l’environnement et le changement climatique Les pays en développement accroissent leurs efforts en R-D
Les pays en développement accroissent leurs efforts en R-D Le tango, la danse Ainu du Japon et la tapisserie d’Aubusson sont inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
Le tango, la danse Ainu du Japon et la tapisserie d’Aubusson sont inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité Lancement de la base de données et de la Communauté de bonnes pratiques sur l'eau et la diversité culturelle
Lancement de la base de données et de la Communauté de bonnes pratiques sur l'eau et la diversité culturelle Le Conseil exécutif de l’UNESCO a choisi Irina Bokova comme candidate au poste de Directeur général
Le Conseil exécutif de l’UNESCO a choisi Irina Bokova comme candidate au poste de Directeur général L’UNESCO organise à Monza (Italie) le premier Forum mondial des industries culturelles
L’UNESCO organise à Monza (Italie) le premier Forum mondial des industries culturelles Nouvelle Chaire UNESCO d’esthétique et de sociologie de la différence et de la diversité culturelle en Argentine
Nouvelle Chaire UNESCO d’esthétique et de sociologie de la différence et de la diversité culturelle en Argentine International Conference on « Globalization through Localization: Cultural dialogue through Harry Potter Translations » (Septembre, 8th 2009, Paris)
International Conference on « Globalization through Localization: Cultural dialogue through Harry Potter Translations » (Septembre, 8th 2009, Paris) Etudes de cas sur le changement climatique et le patrimoine mondial
Etudes de cas sur le changement climatique et le patrimoine mondial L’UNESCO organise la première conférence internationale sur la radiotélévision et le changement climatique (les 4-5 septembre 2009 à Paris)
L’UNESCO organise la première conférence internationale sur la radiotélévision et le changement climatique (les 4-5 septembre 2009 à Paris) UNESCO Audiovisual E-Platform renewed
UNESCO Audiovisual E-Platform renewed Journée internationale des peuples autochtones: 9 août 2009 - Message de M. Koïchiro Matsuura, directeur général de l’UNESCO
Journée internationale des peuples autochtones: 9 août 2009 - Message de M. Koïchiro Matsuura, directeur général de l’UNESCO L’UNESCO organise un forum sur « l’égalité des sexes et le changement climatique » à la Conférence mondiale sur le climat - 3 (31 août - 4 septembre 2009, Genève - Suisse)
L’UNESCO organise un forum sur « l’égalité des sexes et le changement climatique » à la Conférence mondiale sur le climat - 3 (31 août - 4 septembre 2009, Genève - Suisse) Communiqué de la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur 2009 : La nouvelle dynamique de l’enseignement supérieur et de la recherche au service du progrès social et du développement
Communiqué de la Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur 2009 : La nouvelle dynamique de l’enseignement supérieur et de la recherche au service du progrès social et du développement Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur, tendances, questions et enjeux actuels de l’enseignement supérieur
Conférence mondiale sur l’enseignement supérieur, tendances, questions et enjeux actuels de l’enseignement supérieur La Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur entend répondre aux grands défis mondiaux (5-8 juillet 2009, Paris)
La Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur entend répondre aux grands défis mondiaux (5-8 juillet 2009, Paris) Diversité, synonyme de culture
Diversité, synonyme de culture Résolutions de la 2ème session de la Conférence des Parties à la Convention sur le protection et le promotion de la diversité des expressions culturelles (15-16 juin 2009, Paris)
Résolutions de la 2ème session de la Conférence des Parties à la Convention sur le protection et le promotion de la diversité des expressions culturelles (15-16 juin 2009, Paris) Les Sommets du G-20 et le système ONU : perspectives et défis (Conférence UNESCO du futur du 18 juin 2009)
Les Sommets du G-20 et le système ONU : perspectives et défis (Conférence UNESCO du futur du 18 juin 2009) La technologie ne suffit pas à réduire les fractures du savoir
La technologie ne suffit pas à réduire les fractures du savoir La corruption dans le domaine de l’éducation : un problème mondial selon un nouveau rapport de l’UNESCO
La corruption dans le domaine de l’éducation : un problème mondial selon un nouveau rapport de l’UNESCO Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles: 2ème session ordinaire de la Conférence des Parties (15-19 juin 2009, Paris)
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles: 2ème session ordinaire de la Conférence des Parties (15-19 juin 2009, Paris) L’OTP pourrait devenir un centre de ressources du cyber-réseau pour l’apprentissage des langues
L’OTP pourrait devenir un centre de ressources du cyber-réseau pour l’apprentissage des langues Festival international de la Diversité culturelle 2009 (11-22 mai 2009)
Festival international de la Diversité culturelle 2009 (11-22 mai 2009) Production cinématographique : Nollywood rivalise avec Bollywood
Production cinématographique : Nollywood rivalise avec Bollywood L’UNESCO cherche de nouvelles façons d’impliquer les leaders mondiaux dans un dialogue constructif
L’UNESCO cherche de nouvelles façons d’impliquer les leaders mondiaux dans un dialogue constructif Nicolas Bailly : « Chacun doit pouvoir s’approprier ‘sa’ protection de la diversité »
Nicolas Bailly : « Chacun doit pouvoir s’approprier ‘sa’ protection de la diversité » L'aide à l'éducation de base diminue fortement, compromettant les chances de scolarisation de millions d'enfants
L'aide à l'éducation de base diminue fortement, compromettant les chances de scolarisation de millions d'enfants L’UNESCO, la Bibliothèque du Congrès et d’autres partenaires ont lancé la Bibliothèque numérique mondiale
L’UNESCO, la Bibliothèque du Congrès et d’autres partenaires ont lancé la Bibliothèque numérique mondiale L’UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la prévention et de l’élimination du racisme à la Conférence d’examen de Durban, Genève, 20-24 avril 2009
L’UNESCO réaffirme son engagement en faveur de la prévention et de l’élimination du racisme à la Conférence d’examen de Durban, Genève, 20-24 avril 2009 After the G20: UN chiefs point the way to recovery
After the G20: UN chiefs point the way to recovery L’UNESCO va organiser à Monza (Italie) le premier Forum mondial des industries culturelles
L’UNESCO va organiser à Monza (Italie) le premier Forum mondial des industries culturelles L’UNESCO, la Bibliothèque du Congrès et d’autres partenaires lancent la Bibliothèque numérique mondiale
L’UNESCO, la Bibliothèque du Congrès et d’autres partenaires lancent la Bibliothèque numérique mondiale Le Directeur général ouvre la deuxième session extraordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Le Directeur général ouvre la deuxième session extraordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation pour le développement durable (31 mars - 2 avril 2009, Bonn - Allemagne)
Conférence mondiale de l’UNESCO sur l’éducation pour le développement durable (31 mars - 2 avril 2009, Bonn - Allemagne) L’eau est essentielle au développement selon un nouveau rapport
L’eau est essentielle au développement selon un nouveau rapport La crise mondiale frappe les plus vulnérables
La crise mondiale frappe les plus vulnérables 16ème Forum des ministres de la culture et des responsables des politiques culturelles de l'Amérique latine et des Caraïbes
16ème Forum des ministres de la culture et des responsables des politiques culturelles de l'Amérique latine et des Caraïbes UNESCO Director-General calls for increased investment in global public goods at World Economic Forum in Davos
UNESCO Director-General calls for increased investment in global public goods at World Economic Forum in Davos L’UNESCO présente la nouvelle édition de son Atlas des langues en danger dans le monde
L’UNESCO présente la nouvelle édition de son Atlas des langues en danger dans le monde Journée internationale de la langue maternelle, 21 février
Journée internationale de la langue maternelle, 21 février Lancement à l’UNESCO de l’Année mondiale de l’astronomie
Lancement à l’UNESCO de l’Année mondiale de l’astronomie Les cinéastes éthiopiens relèvent le défi du développement
Les cinéastes éthiopiens relèvent le défi du développement Les nouvelles dynamiques de l’enseignement supérieur
Les nouvelles dynamiques de l’enseignement supérieur Diversité des expressions culturelles : coopération internationale et développement durable à l’ordre du jour d’une réunion intergouvernementale à l’UNESCO (8-12 décembre 2008, Paris)
Diversité des expressions culturelles : coopération internationale et développement durable à l’ordre du jour d’une réunion intergouvernementale à l’UNESCO (8-12 décembre 2008, Paris) Rencontre débat "Culture, économie, intégration régionale - La culture, levier du développement en Afrique" (16 decembre 2008, Maison de l'Unesco, Paris)
Rencontre débat "Culture, économie, intégration régionale - La culture, levier du développement en Afrique" (16 decembre 2008, Maison de l'Unesco, Paris) L'inégalité compromet les chances d'éducation de millions d'enfants
L'inégalité compromet les chances d'éducation de millions d'enfants Naissance à Istanbul de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité
Naissance à Istanbul de la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité Message de M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel : « Le patrimoine audiovisuel, témoin de l’identité culturelle »
Message de M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de l’UNESCO, à l’occasion de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel : « Le patrimoine audiovisuel, témoin de l’identité culturelle » L’UNESCO publie la première carte mondiale des réserves d’eau souterraines transfrontalières
L’UNESCO publie la première carte mondiale des réserves d’eau souterraines transfrontalières 2ème session ordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (8-12 décembre 2008, Siège de l’UNESCO, Paris)
2ème session ordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (8-12 décembre 2008, Siège de l’UNESCO, Paris) Une conférence danoise met à l’honneur l’éducation pour le dialogue interculturel
Une conférence danoise met à l’honneur l’éducation pour le dialogue interculturel Quarantième anniversaire d’Auroville à l’UNESCO
Quarantième anniversaire d’Auroville à l’UNESCO La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique entrera en vigueur en janvier 2009
La Convention de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel subaquatique entrera en vigueur en janvier 2009 Le Comité international de bioéthique de l’UNESCO se penche de nouveau sur le clonage
Le Comité international de bioéthique de l’UNESCO se penche de nouveau sur le clonage Projet de compte rendu analytique de la première session extraordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (juin 2008, Paris)
Projet de compte rendu analytique de la première session extraordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (juin 2008, Paris) Les efforts internationaux en faveur de l’alphabétisation sont très insuffisants d’après un rapport de l’UNESCO
Les efforts internationaux en faveur de l’alphabétisation sont très insuffisants d’après un rapport de l’UNESCO "Why Languages Matter" [De l’importance des langues]
"Why Languages Matter" [De l’importance des langues] Journée mondiale des enseignants 2008 : 18 millions de professeurs supplémentaires sont nécessaires
Journée mondiale des enseignants 2008 : 18 millions de professeurs supplémentaires sont nécessaires Une conférence internationale jette les bases du multilinguisme dans le cyberespace
Une conférence internationale jette les bases du multilinguisme dans le cyberespace Lena Resolution on linguistic and cultural diversity in cyberspace
Lena Resolution on linguistic and cultural diversity in cyberspace Premier succès du projet d’UNESCO-Hewlett-Packard et du CNRS pour lutter contre la fuite des cerveaux en Afrique
Premier succès du projet d’UNESCO-Hewlett-Packard et du CNRS pour lutter contre la fuite des cerveaux en Afrique A l'occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation 2008, l'ISU publie un nouveau rapport sur les concepts, la méthodologie et les tendances relatifs aux statistiques de l'alphabétisation
A l'occasion de la Journée internationale de l’alphabétisation 2008, l'ISU publie un nouveau rapport sur les concepts, la méthodologie et les tendances relatifs aux statistiques de l'alphabétisation « Au Moyen-Orient, les données relatives à l’eau sont classées confidentiel »
« Au Moyen-Orient, les données relatives à l’eau sont classées confidentiel » Vingt-sept nouveaux sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO cette année
Vingt-sept nouveaux sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO cette année Huit nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : depuis le détroit de Malacca, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en passant par Saint-Marin
Huit nouveaux sites sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO : depuis le détroit de Malacca, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, en passant par Saint-Marin Décisions de la 1ère session extraordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (les 24-27 juin, Paris)
Décisions de la 1ère session extraordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (les 24-27 juin, Paris) Lyon devient la première « Ville des arts numériques » du réseau UNESCO des Villes créatives
Lyon devient la première « Ville des arts numériques » du réseau UNESCO des Villes créatives Session extraordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Session extraordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles Les chefs d’Etat de l’Europe du Sud-Est s’engagent à mettre les voies navigables régionales au service de la compréhension
Les chefs d’Etat de l’Europe du Sud-Est s’engagent à mettre les voies navigables régionales au service de la compréhension Deuxième session de l’Assemblée générale des Etats parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (16-19 juin 2008, Paris)
Deuxième session de l’Assemblée générale des Etats parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (16-19 juin 2008, Paris) Les enfants défavorisés sont désavantagés à l’école, selon une étude de l’UNESCO
Les enfants défavorisés sont désavantagés à l’école, selon une étude de l’UNESCO Première session extraordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (24-27 juin 2008, Paris)
Première session extraordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (24-27 juin 2008, Paris) Message du Directeur général de l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et pour le développement
Message du Directeur général de l'UNESCO à l'occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et pour le développement Journée mondiale de la diversité culturelle: 21 mai 2008
Journée mondiale de la diversité culturelle: 21 mai 2008 La libertad de información, vital para la autonomía y la democracia, según participantes en la conferencia de la UNESCO - Día Mundial de la Libertad de Prensa 2008
La libertad de información, vital para la autonomía y la democracia, según participantes en la conferencia de la UNESCO - Día Mundial de la Libertad de Prensa 2008 23 avril, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur
23 avril, Journée mondiale du livre et du droit d'auteur L'aide à l'éducation de base stagne, selon le Rapport mondial de suivi sur l'Education pour tous de l'UNESCO
L'aide à l'éducation de base stagne, selon le Rapport mondial de suivi sur l'Education pour tous de l'UNESCO Semana Mundial de Acción por la Educación para Todos 2008 (21-27 de abril)
Semana Mundial de Acción por la Educación para Todos 2008 (21-27 de abril) Il faut changer les règles de l’agriculture moderne selon un rapport présenté à l’UNESCO
Il faut changer les règles de l’agriculture moderne selon un rapport présenté à l’UNESCO Gérer l’inévitable et éviter l’ingérable – nous en sommes là, selon le climatologue italien Filippo Giorgi
Gérer l’inévitable et éviter l’ingérable – nous en sommes là, selon le climatologue italien Filippo Giorgi Projet de compte rendu analytique de la Première session ordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Projet de compte rendu analytique de la Première session ordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles Message de M. Koïchiro Matsuura, directeur général de l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau : l’assainissement
Message de M. Koïchiro Matsuura, directeur général de l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale de l’eau : l’assainissement Programme du Colloque "Dialogue interculturel et diversité culturelle: un débat renouvelé" à l'occasion du lancement en France de "2008, Année européenne du dialogue interculturel"(13-14 mars 2008, Unesco-Paris)
Programme du Colloque "Dialogue interculturel et diversité culturelle: un débat renouvelé" à l'occasion du lancement en France de "2008, Année européenne du dialogue interculturel"(13-14 mars 2008, Unesco-Paris) Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles - La place de la culture dans le développement durable : réflexions sur la future mise en œuvre de l'article 13
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles - La place de la culture dans le développement durable : réflexions sur la future mise en œuvre de l'article 13 Programme de la journée du lancement de l'Année internationale des langues dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle (21 février 2008, Unesco - Paris)
Programme de la journée du lancement de l'Année internationale des langues dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle (21 février 2008, Unesco - Paris) Le Nigeria accueille le 15e et dernier séminaire national du projet de l’UNESCO sur les défis de l’intégration régionale (26-28 février 2008, Lagos - Nigéria)
Le Nigeria accueille le 15e et dernier séminaire national du projet de l’UNESCO sur les défis de l’intégration régionale (26-28 février 2008, Lagos - Nigéria) Les langues, ça compte (Le Courrier de l'Unesco 2008, n°1)
Les langues, ça compte (Le Courrier de l'Unesco 2008, n°1) Le 3e Congrès des réserves de biosphère propose au programme MAB de l’UNESCO des lignes d’action pour les 6 ans à venir
Le 3e Congrès des réserves de biosphère propose au programme MAB de l’UNESCO des lignes d’action pour les 6 ans à venir Lancement de l'Année internationale des langues dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle (21 février 2008, Paris)
Lancement de l'Année internationale des langues dans le cadre de la Journée internationale de la langue maternelle (21 février 2008, Paris) Troisième Congrès mondial des réserves de biosphère (4-9 février 2008, Madrid)
Troisième Congrès mondial des réserves de biosphère (4-9 février 2008, Madrid) L’UNESCO va lancer de nouveaux indicateurs pour l’évaluation et la comparaison des systèmes nationaux de recherche
L’UNESCO va lancer de nouveaux indicateurs pour l’évaluation et la comparaison des systèmes nationaux de recherche Le Directeur général de l’UNESCO participera à Madrid au premier Forum de l’Alliance des civilisations
Le Directeur général de l’UNESCO participera à Madrid au premier Forum de l’Alliance des civilisations International Year of Planet Earth
International Year of Planet Earth Le Comité intergouvernemental de l’UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles se clôt à Ottawa sur un appel à l’action
Le Comité intergouvernemental de l’UNESCO pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles se clôt à Ottawa sur un appel à l’action 'Culture or Commerce? A Comparative Assessment of International Interactions and Developing Countries at UNESCO, WTO, and Beyond', by J. P. Singh
'Culture or Commerce? A Comparative Assessment of International Interactions and Developing Countries at UNESCO, WTO, and Beyond', by J. P. Singh 'A study on creativity index', by Desmond Hui
'A study on creativity index', by Desmond Hui ‘Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: Possible Statistical Implications?’ by Mirja Liikkanen
‘Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions: Possible Statistical Implications?’ by Mirja Liikkanen Education for All Global Monitoring Report 2008
Education for All Global Monitoring Report 2008 L’éducation pour tous est sur la bonne voie d’après l’édition 2008 du Rapport mondial de suivi lancé par l’UNESCO
L’éducation pour tous est sur la bonne voie d’après l’édition 2008 du Rapport mondial de suivi lancé par l’UNESCO Première session ordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (10-13 décembre 2007, Ottawa - Canada)
Première session ordinaire du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (10-13 décembre 2007, Ottawa - Canada) La musique comme vecteur de dialogue entre les cultures
La musique comme vecteur de dialogue entre les cultures Message de M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de l’UNESCO, en vue de la célébration de « 2008 Année internationale des langues », « Les langues, ça compte ! »
Message de M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de l’UNESCO, en vue de la célébration de « 2008 Année internationale des langues », « Les langues, ça compte ! » L'UNESCO dénonce les attaques contre les enseignants, les élèves et les écoles
L'UNESCO dénonce les attaques contre les enseignants, les élèves et les écoles Journée Mondiale de la Philosophie, 15 novembre 2007
Journée Mondiale de la Philosophie, 15 novembre 2007 La Conférence générale définit la stratégie de l’UNESCO pour les six ans à venir
La Conférence générale définit la stratégie de l’UNESCO pour les six ans à venir Une nouvelle publication sur l’enseignement supérieur privé en Europe
Une nouvelle publication sur l’enseignement supérieur privé en Europe The rising role and relevance of private higher education in Europe (Study)
The rising role and relevance of private higher education in Europe (Study) Neuf nouveaux membres élus au Comité du patrimoine mondial
Neuf nouveaux membres élus au Comité du patrimoine mondial Exhibit "Planet earth : from space to place" (16th oct. - 3rd nov. 2007)
Exhibit "Planet earth : from space to place" (16th oct. - 3rd nov. 2007) L’UNESCO et la Bibliothèque du Congrès signent un accord sur la Bibliothèque numérique mondiale
L’UNESCO et la Bibliothèque du Congrès signent un accord sur la Bibliothèque numérique mondiale Le président bulgare souligne la contribution de l’UNESCO à l’entente entre les peuples lors de l’ouverture de la Conférence générale
Le président bulgare souligne la contribution de l’UNESCO à l’entente entre les peuples lors de l’ouverture de la Conférence générale Education et développement au centre de la 34e Conférence générale de l’UNESCO (16 octobre – 3 novembre)
Education et développement au centre de la 34e Conférence générale de l’UNESCO (16 octobre – 3 novembre) Recueil de données mondiales sur l’éducation 2007
Recueil de données mondiales sur l’éducation 2007 Les dépenses consacrées à l’éducation restent concentrées dans quelques pays
Les dépenses consacrées à l’éducation restent concentrées dans quelques pays Education et développement au centre de la 34e Conférence générale de l’UNESCO (16 octobre – 3 novembre)
Education et développement au centre de la 34e Conférence générale de l’UNESCO (16 octobre – 3 novembre) Journée mondiale des enseignants 2007
Journée mondiale des enseignants 2007 L’UNESCO va désigner de nouvelles réserves de biosphère
L’UNESCO va désigner de nouvelles réserves de biosphère Le nombre des décès d'enfants tombe pour la première fois sous la barre des 10 millions
Le nombre des décès d'enfants tombe pour la première fois sous la barre des 10 millions Entretien avec M. Alexander Marc : « Éducation des Roms : nous n’avons aucune raison d’être si pessimistes ».
Entretien avec M. Alexander Marc : « Éducation des Roms : nous n’avons aucune raison d’être si pessimistes ». Réunion d’experts sur la mesure statistique de la diversité des expressions culturelles
Réunion d’experts sur la mesure statistique de la diversité des expressions culturelles Les premières inscriptions sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO auront lieu en septembre 2009
Les premières inscriptions sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO auront lieu en septembre 2009 Nouvelle enquête mondiale sur le cinéma
Nouvelle enquête mondiale sur le cinéma Les pays d’Asie de l’Est, du Sud-Est et du Pacifique s’engagent en faveur de l’alphabétisation
Les pays d’Asie de l’Est, du Sud-Est et du Pacifique s’engagent en faveur de l’alphabétisation Accès inégal à la formation pour adultes : perspectives internationales / Richard Desjardins, Kjell Rubenson, Marcella Milana
Accès inégal à la formation pour adultes : perspectives internationales / Richard Desjardins, Kjell Rubenson, Marcella Milana Entretien avec Mark Richmond: « En dépit de progrès indéniables, des inégalités importantes subsistent entre hommes et femmes »
Entretien avec Mark Richmond: « En dépit de progrès indéniables, des inégalités importantes subsistent entre hommes et femmes » Lutter contre l’analphabétisme en Asie de l’Est, du Sud-Est et dans le Pacifique
Lutter contre l’analphabétisme en Asie de l’Est, du Sud-Est et dans le Pacifique Nomination de Beyrouth « Capitale mondiale du livre 2009 »
Nomination de Beyrouth « Capitale mondiale du livre 2009 » Proclamation des lauréats 2007 des Prix d’alphabétisation de l’UNESCO
Proclamation des lauréats 2007 des Prix d’alphabétisation de l’UNESCO Equipe spéciale sur les langues et le multilinguisme: revue des activités en cours portant sur les langues et le multilinguisme (2006-2007)
Equipe spéciale sur les langues et le multilinguisme: revue des activités en cours portant sur les langues et le multilinguisme (2006-2007) Les campagnes internationales de sauvegarde du patrimoine mondial
Les campagnes internationales de sauvegarde du patrimoine mondial La Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles s’est tenue à l’UNESCO
La Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles s’est tenue à l’UNESCO Jean Musitelli: "Le succès de la Convention dépend de la volonté des Etats"
Jean Musitelli: "Le succès de la Convention dépend de la volonté des Etats" Première session à l’UNESCO de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Première session à l’UNESCO de la Conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles La corruption dans le domaine de l’éducation est un problème mondial selon un nouveau rapport de l’UNESCO
La corruption dans le domaine de l’éducation est un problème mondial selon un nouveau rapport de l’UNESCO 15e Forum des ministres de la Culture et des responsables des politiques culturelles en Amérique latine et dans les Caraïbes
15e Forum des ministres de la Culture et des responsables des politiques culturelles en Amérique latine et dans les Caraïbes  Prix Médias "Boundless/ Sans frontières"” : appel à candidatures
Prix Médias "Boundless/ Sans frontières"” : appel à candidatures Lancement officiel du Centre mondial de documentation sur les langues
Lancement officiel du Centre mondial de documentation sur les langues Programme de la réunion « Pour une intégration des principes de la diversité culturelle et du dialogue interculturel dans les politiques du développement durable » (Unesco, Paris, 21 - 23 mai 2007)
Programme de la réunion « Pour une intégration des principes de la diversité culturelle et du dialogue interculturel dans les politiques du développement durable » (Unesco, Paris, 21 - 23 mai 2007) Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement
Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement Colloque "Migrations : en finir avec les inquiétudes" (Paris, 10 mai 2007)
Colloque "Migrations : en finir avec les inquiétudes" (Paris, 10 mai 2007) L’UNESCO célèbre à Medellin (Colombie) la Journée mondiale de la liberté de la presse 2007 qui sera consacrée à la sécurité des journalistes
L’UNESCO célèbre à Medellin (Colombie) la Journée mondiale de la liberté de la presse 2007 qui sera consacrée à la sécurité des journalistes Conférence : Conventions de l’UNESCO dans le domaine de la culture et législations nationales des pays de la Communauté des États indépendants (26 avril 2007)
Conférence : Conventions de l’UNESCO dans le domaine de la culture et législations nationales des pays de la Communauté des États indépendants (26 avril 2007) Report: "Case Studies on Climate Change and World Heritage"
Report: "Case Studies on Climate Change and World Heritage" Les changements climatiques mettent en péril des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO
Les changements climatiques mettent en péril des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO The Protection and Promotion of Musical Diversity
The Protection and Promotion of Musical Diversity Exposition de photos "Patrimoine vivant : à la découverte de l’immatériel" (du 12 avril au 30 novembre 2007)
Exposition de photos "Patrimoine vivant : à la découverte de l’immatériel" (du 12 avril au 30 novembre 2007) Actes du Colloque international sur les statistiques culturelles (Montréal, 21-23 octobre 2002)
Actes du Colloque international sur les statistiques culturelles (Montréal, 21-23 octobre 2002) Forum universel des cultures - Monterrey 2007 (20 sept.- 17 nov. 2007, Monterrey, Mexique)
Forum universel des cultures - Monterrey 2007 (20 sept.- 17 nov. 2007, Monterrey, Mexique) L’UNESCO réunit les ministres latino-américains et caribéens pour parler de la qualité de l’éducation
L’UNESCO réunit les ministres latino-américains et caribéens pour parler de la qualité de l’éducation La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles entre en vigueur
La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles entre en vigueur Conférence : Diversité culturelle - La richesse de l'Europe. Faire vivre la Convention de l'UNESCO
Conférence : Diversité culturelle - La richesse de l'Europe. Faire vivre la Convention de l'UNESCO Journée internationale de la langue maternelle
Journée internationale de la langue maternelle Actes du colloque "Diversité culturelle et valeurs transversales : un dialogue est-ouest sur la dynamique entre le spirituel et le temporel"
Actes du colloque "Diversité culturelle et valeurs transversales : un dialogue est-ouest sur la dynamique entre le spirituel et le temporel" 21e Congrès Mondial de Recherche en Danse : "Danseurs sans frontières"
21e Congrès Mondial de Recherche en Danse : "Danseurs sans frontières" Post-conflit : reconstruire l'avenir
Post-conflit : reconstruire l'avenir La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles entrera en vigueur le 18 mars 2007
La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles entrera en vigueur le 18 mars 2007 La Journée mondiale de la philosophie et la Journée internationale de la tolérance célébrées à travers le monde le 16 novembre
La Journée mondiale de la philosophie et la Journée internationale de la tolérance célébrées à travers le monde le 16 novembre Plus de 15 Etats ont ratifié la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Plus de 15 Etats ont ratifié la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous 2007
Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous 2007 Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles Journée internationale des populations autochtones, 9 août 2006
Journée internationale des populations autochtones, 9 août 2006  Au sommet du G8 à Saint-Pétersbourg, le Directeur général évoque le fossé financier de l’éducation
Au sommet du G8 à Saint-Pétersbourg, le Directeur général évoque le fossé financier de l’éducation Première réunion des Etats parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Première réunion des Etats parties à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel Les scientifiques réunis à Tunis proposent des mesures pour aider à contenir la désertification
Les scientifiques réunis à Tunis proposent des mesures pour aider à contenir la désertification L'avenir des terres sèches
L'avenir des terres sèches Message du Directeur général de l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement (21 mai 2006)
Message du Directeur général de l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement (21 mai 2006) UNESCO contributing to peace and human development in an era of globalization through education, the sciences, culture and communication
UNESCO contributing to peace and human development in an era of globalization through education, the sciences, culture and communication 31st ITI World Congress and Theatre Olympics of the Nations
31st ITI World Congress and Theatre Olympics of the Nations  Message du Directeur général de l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, 23 avril 2006
Message du Directeur général de l’UNESCO à l’occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, 23 avril 2006  Petites îles, grands enjeux
Petites îles, grands enjeux  Le deuxième Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau fait état d’une crise de gouvernance
Le deuxième Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des ressources en eau fait état d’une crise de gouvernance Towards Knowledge Societies – the first UNESCO World Report
Towards Knowledge Societies – the first UNESCO World Report Education pour tous - Rapport mondial de suivi 2006 : L’alphabétisation, un enjeu vital
Education pour tous - Rapport mondial de suivi 2006 : L’alphabétisation, un enjeu vital Women’s Literacy for Sustainable Development
Women’s Literacy for Sustainable Development Recherche profs désespérement
Recherche profs désespérement  Préparer la prochaine génération d'enseignants en Afrique
Préparer la prochaine génération d'enseignants en Afrique Opening of the Sixth E-9 Ministerial Review Meeting in Monterrey, Mexico
Opening of the Sixth E-9 Ministerial Review Meeting in Monterrey, Mexico China challenges dominance of USA, Europe and Japan in scientific research according to UNESCO Science Report 2005
China challenges dominance of USA, Europe and Japan in scientific research according to UNESCO Science Report 2005 Rapport 2005 de l’UNESCO sur la science / UNESCO
Rapport 2005 de l’UNESCO sur la science / UNESCO 22 Mars - Journée mondiale de l'eau 2006 : l'eau et la culture
22 Mars - Journée mondiale de l'eau 2006 : l'eau et la culture Vie et mort des langues: les locuteurs décident
Vie et mort des langues: les locuteurs décident Language Vitality and Endangerment
Language Vitality and Endangerment 21 février 2006 :Journée internationale de la langue maternelle
21 février 2006 :Journée internationale de la langue maternelle  Expert Meeting for Policy Leaders and Decision Makers in the Broadcasting and Audio-visual Industry in Asia
Expert Meeting for Policy Leaders and Decision Makers in the Broadcasting and Audio-visual Industry in Asia Séminaire sous-régional sur les “Indicateurs culturels en Amérique centrale”
Séminaire sous-régional sur les “Indicateurs culturels en Amérique centrale” Pour la 3e Conférence mondiale sur les océans, les objectifs en matière d’océans ne seront pas atteints dans les délais
Pour la 3e Conférence mondiale sur les océans, les objectifs en matière d’océans ne seront pas atteints dans les délais La Conférence mondiale sur les océans, les côtes et les îles va se pencher sur l’avenir des écosystèmes marins
La Conférence mondiale sur les océans, les côtes et les îles va se pencher sur l’avenir des écosystèmes marins La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel entrera en vigueur le 20 avril
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel entrera en vigueur le 20 avril Le Canada devient le premier Etat à ratifier la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Le Canada devient le premier Etat à ratifier la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles  L’UNESCO lance un portail de l’alphabétisation
L’UNESCO lance un portail de l’alphabétisation Bhaktapur : un musée à ciel ouvert
Bhaktapur : un musée à ciel ouvert Radio Ada, la voix des sans-voix
Radio Ada, la voix des sans-voix Panser la frature entre le Nord et le Sud
Panser la frature entre le Nord et le Sud La ruée vers l'eau
La ruée vers l'eau La diversité culturelle ne se décrète ni ne s’improvise
La diversité culturelle ne se décrète ni ne s’improvise La créativité dans tous ses éclats
La créativité dans tous ses éclats Au chevet de la planète
Au chevet de la planète Les cellules de la discorde
Les cellules de la discorde Au Paraguay, on connaît la chanson
Au Paraguay, on connaît la chanson Le difficile point d'équilibre
Le difficile point d'équilibre Education pour tous – Rapport mondial de suivi 2005
Education pour tous – Rapport mondial de suivi 2005 Le grand bleu sous surveillance
Le grand bleu sous surveillance Le changement climatique / Par Guy Jacques et Hervé Le Treut
Le changement climatique / Par Guy Jacques et Hervé Le Treut Eliminer les disparités entre les sexes
Eliminer les disparités entre les sexes Les pays en développement sont les perdants du commerce des biens culturels
Les pays en développement sont les perdants du commerce des biens culturels L' engagement de Rabat
L' engagement de Rabat La Samba de Roda et le Ramlila figurent désormais parmi les Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité
La Samba de Roda et le Ramlila figurent désormais parmi les Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité Troisième proclamation des Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité
Troisième proclamation des Chefs-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité Musique traditionnelle du monde
Musique traditionnelle du monde  Afin de favoriser la présence des langues africaines dans le cyberespace, l’UNESCO continue de soutenir le projet n’ko
Afin de favoriser la présence des langues africaines dans le cyberespace, l’UNESCO continue de soutenir le projet n’ko La Conférence générale adopte la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
La Conférence générale adopte la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles Kultur versus Freihandel
Kultur versus Freihandel Projet de Convention internationale sur la diversité culturelle - texte en projet résultant des négociations intergouvernementales
Projet de Convention internationale sur la diversité culturelle - texte en projet résultant des négociations intergouvernementales Les chefs d’Etats de la Bosnie-Herzégovine et du Tadjikistan défendent le dialogue et la diversité culturelle devant la Conférence générale de l’UNESCO
Les chefs d’Etats de la Bosnie-Herzégovine et du Tadjikistan défendent le dialogue et la diversité culturelle devant la Conférence générale de l’UNESCO Prévention des catastrophes naturelles
Prévention des catastrophes naturelles Journée Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté - 18-19 Octobre 2004, Maison de l'UNESCO, Paris
Journée Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté - 18-19 Octobre 2004, Maison de l'UNESCO, Paris Diversité culturelle, dopage et bioéthique au programme de la Conférence générale de l’UNESCO
Diversité culturelle, dopage et bioéthique au programme de la Conférence générale de l’UNESCO Vingt-et-un Etats ont ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
Vingt-et-un Etats ont ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel The World Forum on Cultural Diversity
The World Forum on Cultural Diversity UNESCO prepares to launch new ICT teacher training project
UNESCO prepares to launch new ICT teacher training project Journée internationale des populations autochtones, 9 août 2005
Journée internationale des populations autochtones, 9 août 2005 Le patrimoine mondial aux mains des jeunes
Le patrimoine mondial aux mains des jeunes Lest we forget: the triumph over slavery
Lest we forget: the triumph over slavery Souvenirs d'humanité
Souvenirs d'humanité Exposition photographique: Mémoires de l’Humanité
Exposition photographique: Mémoires de l’Humanité Musiques africaines
Musiques africaines Action en faveur des peuples autochtones
Action en faveur des peuples autochtones Artistic practices and techniques from Europe and North America favouring social cohesion and peace
Artistic practices and techniques from Europe and North America favouring social cohesion and peace Le Président Lula da Silva va inaugurer l’exposition «L’UNESCO et le Brésil»
Le Président Lula da Silva va inaugurer l’exposition «L’UNESCO et le Brésil» Le lancement du Système d’alerte aux tsunamis dans l’océan Indien aura lieu lors de l’Assemblée de la COI en juin
Le lancement du Système d’alerte aux tsunamis dans l’océan Indien aura lieu lors de l’Assemblée de la COI en juin 29 nouvelles inscriptions sur le Registre Mémoire du Monde des collections documentaires
29 nouvelles inscriptions sur le Registre Mémoire du Monde des collections documentaires Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI)
Sommet Mondial sur la Société de l’Information (SMSI)  Sortie du rapport Education Pour Tous en Afrique - Repères pour l’Action
Sortie du rapport Education Pour Tous en Afrique - Repères pour l’Action Dialogue entre les cultures et les civilisations : conférence internationale à Rabat
Dialogue entre les cultures et les civilisations : conférence internationale à Rabat Primeras Jornadas del MERCOSUR
Primeras Jornadas del MERCOSUR sobre Políticas Culturales para la Diversidad Cultural
 Propuesta de Plan Cultural de las Tres Fronteras
Propuesta de Plan Cultural de las Tres Fronteras Deuxième réunion des ministres de la culture d'Asie et d'Europe (ASEM)
Deuxième réunion des ministres de la culture d'Asie et d'Europe (ASEM) Le principe de précaution
Le principe de précaution Multilingualism in cyberspace conference concluded in Bamako
Multilingualism in cyberspace conference concluded in Bamako Discours de M. Koïchiro Matsuura sur l’avant-projet de convention concernant la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
Discours de M. Koïchiro Matsuura sur l’avant-projet de convention concernant la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques UNESCO e NASA firmam parceria
UNESCO e NASA firmam parceria Patrimoine mondial et architecture contemporaine : vers de nouveaux standards de conservation
Patrimoine mondial et architecture contemporaine : vers de nouveaux standards de conservation Rencontres sahariennes
Rencontres sahariennes Diversité culturelle et mondialisation : L’expérience arabo-japonaise, un dialogue interrégional
Diversité culturelle et mondialisation : L’expérience arabo-japonaise, un dialogue interrégional  Le Recueil de données mondiales sur l’éducation fait état d'une progression rapide de l'enseignement secondaire dans le monde
Le Recueil de données mondiales sur l’éducation fait état d'une progression rapide de l'enseignement secondaire dans le monde 171e Conseil exécutif de l’UNESCO : La troisième session de la Réunion intergouvernementale d’experts sur le projet de Convention se tiendra du 25 mai au 4 juin 2005 à Paris
171e Conseil exécutif de l’UNESCO : La troisième session de la Réunion intergouvernementale d’experts sur le projet de Convention se tiendra du 25 mai au 4 juin 2005 à Paris  Diogène, no. 209: "Approches de l'Utopie"
Diogène, no. 209: "Approches de l'Utopie"  Rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
Rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques Information Meeting with Permanent Delegations on the Strategic Review and Implementation Plans of UNESCO’s Post-Dakar Role in Education for All (EFA)
Information Meeting with Permanent Delegations on the Strategic Review and Implementation Plans of UNESCO’s Post-Dakar Role in Education for All (EFA) Participation de la Communauté européenne à la Réunion intergouvernementale des experts (catégorie II) sur l'avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
Participation de la Communauté européenne à la Réunion intergouvernementale des experts (catégorie II) sur l'avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques Des experts sonnent l’alarme : les changements survenus dans les écosystèmes menacent le développement
Des experts sonnent l’alarme : les changements survenus dans les écosystèmes menacent le développement Cha, In-Suk
Cha, In-Suk Célébration de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale
Célébration de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 22 Mars : La Journée mondiale de l'eau inaugure la Décennie internationale d'action "L'eau, source de vie"
22 Mars : La Journée mondiale de l'eau inaugure la Décennie internationale d'action "L'eau, source de vie" Partie II - Résultats des travaux du groupe de travail informel
Partie II - Résultats des travaux du groupe de travail informel Partie I - Résultats des travaux du comité de rédaction
Partie I - Résultats des travaux du comité de rédaction Rapport préliminaire du Directeur Général contenant deux avant-projets de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
Rapport préliminaire du Directeur Général contenant deux avant-projets de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques Les inventaires du patrimoine culturel immatériel
Les inventaires du patrimoine culturel immatériel  Diversité culturelle et pluralisme
Diversité culturelle et pluralisme Rapport préliminaire du Directeur Général contenant deux avant-projets de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
Rapport préliminaire du Directeur Général contenant deux avant-projets de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques Message de M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de l'UNESCO, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, 8 mars 2005
Message de M. Koïchiro Matsuura, Directeur général de l'UNESCO, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, 8 mars 2005 UNESCO treaty on protecting oral traditions could come into force next year
UNESCO treaty on protecting oral traditions could come into force next year International Cultural Forum Beijing 2004 - UNESCO Office Beijing
International Cultural Forum Beijing 2004 - UNESCO Office Beijing Onze Etats ont désormais ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel
Onze Etats ont désormais ratifié la Convention pour la sauvegarde du patrimoine immatériel First edition of the Global Alliance Newsletter
First edition of the Global Alliance Newsletter 6e réunion de l’équipe spéciale intersectorielle chargée de préparer la contribution de l’UNESCO au Sommet mondial sur la société de l’information
6e réunion de l’équipe spéciale intersectorielle chargée de préparer la contribution de l’UNESCO au Sommet mondial sur la société de l’information Deuxième session de la réunion d’experts intergouvernementaux sur l’avant-projet de convention internationale concernant la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques (31 janvier –12 février 2005)
Deuxième session de la réunion d’experts intergouvernementaux sur l’avant-projet de convention internationale concernant la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques (31 janvier –12 février 2005) Première réunion d’experts sur le patrimoine culturel de la Vieille ville de Jérusalem
Première réunion d’experts sur le patrimoine culturel de la Vieille ville de Jérusalem Conférence internationale sur la biodiversité : science et gouvernance
Conférence internationale sur la biodiversité : science et gouvernance L’UNESCO annonce la Stratégie mondiale pour l’établissement d’un système d’alerte avancée
L’UNESCO annonce la Stratégie mondiale pour l’établissement d’un système d’alerte avancée Premier anniversaire du tremblement de terre dans la ville Iranienne de Bam, site du patrimoine mondial
Premier anniversaire du tremblement de terre dans la ville Iranienne de Bam, site du patrimoine mondial L’UNESCO offre son aide aux pays victimes du tsunami
L’UNESCO offre son aide aux pays victimes du tsunami Première réunion du Comité de rédaction sur l’Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
Première réunion du Comité de rédaction sur l’Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques Matsuura, Koïchiro
Matsuura, Koïchiro  Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
Avant-projet de convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques L'UNESCO et Microsoft signent un accord de coopération pour réduire la fracture numérique
L'UNESCO et Microsoft signent un accord de coopération pour réduire la fracture numérique Déclaration de Yamato sur les approches intégrées de la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel
Déclaration de Yamato sur les approches intégrées de la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel  La qualité de l'éducation est insuffisante pour parvenir à l’éducation pour tous d’ici 2015
La qualité de l'éducation est insuffisante pour parvenir à l’éducation pour tous d’ici 2015 Rapport mondial de suivi de l'Education pour tous 2005
Rapport mondial de suivi de l'Education pour tous 2005 Safeguarding of Tangible and Intangible Cultural Heritage: Toward an Integrated Approach
Safeguarding of Tangible and Intangible Cultural Heritage: Toward an Integrated Approach Première réunion d'experts gouvernementaux sur l'avant-projet de Convention sur la protection des contenus culturels et des expressions artistiques
Première réunion d'experts gouvernementaux sur l'avant-projet de Convention sur la protection des contenus culturels et des expressions artistiques Démocratie et gouvernance mondiale
Démocratie et gouvernance mondiale Journée Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté (18-19 Octobre 2004, Maison de l'UNESCO, Paris)
Journée Internationale pour l’Elimination de la Pauvreté (18-19 Octobre 2004, Maison de l'UNESCO, Paris) Appel à une Coalition européenne des villes contre le racisme
Appel à une Coalition européenne des villes contre le racisme Conférence internationale de l'éducation : "Une éducation de qualité pour tous les jeunes: Défis, tendances et priorités"
Conférence internationale de l'éducation : "Une éducation de qualité pour tous les jeunes: Défis, tendances et priorités" Journée internationale de l’alphabétisation
Journée internationale de l’alphabétisation Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition à l'UNESCO
Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition à l'UNESCO Taux d'anaphabétisme dans le monde en 2000
Taux d'anaphabétisme dans le monde en 2000 Espérance de vie scolaire dans le monde
Espérance de vie scolaire dans le monde Où vont les valeurs? / Jérôme Bindé (dir.)
Où vont les valeurs? / Jérôme Bindé (dir.) Construire les Sociétés du savoir : thème majeur d’une session des Dialogues du XXIe siècle, aujourd’hui à Séoul (27-07-2004)
Construire les Sociétés du savoir : thème majeur d’une session des Dialogues du XXIe siècle, aujourd’hui à Séoul (27-07-2004) De nouveaux sites vont etre inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial
De nouveaux sites vont etre inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial  Zum Stand einer internationalen Konventionen zum Schutz der kulturellen Vielfalt
Zum Stand einer internationalen Konventionen zum Schutz der kulturellen Vielfalt 21 mai 2004 - Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement
21 mai 2004 - Journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement Symposium international "Diversité culturelle et mondialisation : l'expérience arabo-japonaise, un dialogue inter-régional"
Symposium international "Diversité culturelle et mondialisation : l'expérience arabo-japonaise, un dialogue inter-régional" "Diversité culturelle : synthèse des travaux préliminaires et des réunions d'experts de catégorie VI et perspectives"
"Diversité culturelle : synthèse des travaux préliminaires et des réunions d'experts de catégorie VI et perspectives" Session d'information avec les délégations permanentes des États membres de l'UNESCO sur le processus d'élaboration d'un avant-projet de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
Session d'information avec les délégations permanentes des États membres de l'UNESCO sur le processus d'élaboration d'un avant-projet de Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques L'eau et la gouvernance : quelques exemples de bonnes pratiques
L'eau et la gouvernance : quelques exemples de bonnes pratiques Unesco Lança Índice de Desenvolvimento Juvenil Inédito no Mundo
Unesco Lança Índice de Desenvolvimento Juvenil Inédito no Mundo  Un nouvel instrument international renforce la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé
Un nouvel instrument international renforce la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé 'Le dialogue suppose l'égalité'
'Le dialogue suppose l'égalité' Première réunion du groupe d'experts sur l'avant-projet de Convention internationale concernant la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
Première réunion du groupe d'experts sur l'avant-projet de Convention internationale concernant la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques UNESCO High-Level Symposium on Knowledge Societies at WSIS concluded
UNESCO High-Level Symposium on Knowledge Societies at WSIS concluded Conférence Internationale des ONG de 2003
Conférence Internationale des ONG de 2003 L'Alliance globale pour la diversité culturelle présente ses premiers résultats
L'Alliance globale pour la diversité culturelle présente ses premiers résultats Commission Sociale: l'éducation et la lutte contre la pauvreté sont les priorités en matière de promotion des Droits de l'Homme
Commission Sociale: l'éducation et la lutte contre la pauvreté sont les priorités en matière de promotion des Droits de l'Homme Las niñas siguen afrontando una fuerte discriminación en el acceso a la escuela
Las niñas siguen afrontando una fuerte discriminación en el acceso a la escuela New Technologies: Mirage or Miracle?
New Technologies: Mirage or Miracle? Un projet de l'UNESCO élabore une méthodologie pour évaluer l’impact des TIC sur la suppression de la pauvreté
Un projet de l'UNESCO élabore une méthodologie pour évaluer l’impact des TIC sur la suppression de la pauvreté Des villes du monde entier se réunissent pour protéger leur diversité biologique et culturelle
Des villes du monde entier se réunissent pour protéger leur diversité biologique et culturelle 2003, Année internationale de l’eau douce: Des flots de promesses, des progrès au compte-gouttes
2003, Année internationale de l’eau douce: Des flots de promesses, des progrès au compte-gouttes Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel - 2003
Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel - 2003 L’UNESCO adopte la déclaration internationale sur les données génétiques humaines
L’UNESCO adopte la déclaration internationale sur les données génétiques humaines  Convention du patrimoine mondial: 14e Assemblée Générale
Convention du patrimoine mondial: 14e Assemblée Générale La 32ème session de la Conférence Générale de l'UNESCO approuve à l'unanimité l'élaboration d'ici 2005 d'une Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques
La 32ème session de la Conférence Générale de l'UNESCO approuve à l'unanimité l'élaboration d'ici 2005 d'une Convention sur la protection de la diversité des contenus culturels et des expressions artistiques Patrimoine immateriel, diversité culturelle et lutte contre la destruction intentionnelle du patrimoine : thèmes clés à l’ordre du jour culturel de la Conférence générale de l’UNESCO
Patrimoine immateriel, diversité culturelle et lutte contre la destruction intentionnelle du patrimoine : thèmes clés à l’ordre du jour culturel de la Conférence générale de l’UNESCO Communiqué de la table ronde ministérielle sur la qualité de l'éducation
Communiqué de la table ronde ministérielle sur la qualité de l'éducation Le président du Kirghizistan plaide à l'UNESCO pour l'éducation et les nouvelles technologies de l’information et de la communication
Le président du Kirghizistan plaide à l'UNESCO pour l'éducation et les nouvelles technologies de l’information et de la communication UNESCO: Débat sur l'élaboration d'une convention internationale contre le dopage dans le sport
UNESCO: Débat sur l'élaboration d'une convention internationale contre le dopage dans le sport  La première dame des Etats-Unis marque le retour de son pays au sein de l'UNESCO par un discours à la conférence générale
La première dame des Etats-Unis marque le retour de son pays au sein de l'UNESCO par un discours à la conférence générale  Des centaines de ministres et cinq chefs d'Etat sont attendus à la conférence générale de l'UNESCO
Des centaines de ministres et cinq chefs d'Etat sont attendus à la conférence générale de l'UNESCO EGOVOS 3: Open Standards and Libre Software in Government
EGOVOS 3: Open Standards and Libre Software in Government Universidades do Rio de Janeiro debatem a globalização
Universidades do Rio de Janeiro debatem a globalização Rapport Mondial sur l'Eau de l'UNESCO : l'inertie politique exacerbe la crise de l'eau / UNESCO
Rapport Mondial sur l'Eau de l'UNESCO : l'inertie politique exacerbe la crise de l'eau / UNESCO Séminaire UNESCO-NEPAD : Conférence de Presse du Directeur Général Koïchiro Matsuura
Séminaire UNESCO-NEPAD : Conférence de Presse du Directeur Général Koïchiro Matsuura Deuxième colloque international: Les civilisations dans le regard de l'autre
Deuxième colloque international: Les civilisations dans le regard de l'autre Message du Directeur général de l'UNESCO à l'occasion de la Journée des droits de l'homme
Message du Directeur général de l'UNESCO à l'occasion de la Journée des droits de l'homme Philosophy day at UNESCO
Philosophy day at UNESCO Inauguration de la Bibliotheca Alexandrina : du papyrus au numérique
Inauguration de la Bibliotheca Alexandrina : du papyrus au numérique Patrimoine immatériel : Adoption de la Déclaration d'Istanbul
Patrimoine immatériel : Adoption de la Déclaration d'Istanbul L'UNESCO se réjouit du retour des Etats-Unis d'Amérique
L'UNESCO se réjouit du retour des Etats-Unis d'Amérique Quatre-vingt ministres de la culture travaillent sur le thème : le patrimoine immatériel, miroir de la diversité culturelle
Quatre-vingt ministres de la culture travaillent sur le thème : le patrimoine immatériel, miroir de la diversité culturelle La diversité culturelle, un facteur essentiel du développement durable
La diversité culturelle, un facteur essentiel du développement durable  L'UNESCO defend la diversité culturelle et l'éducation au Sommet Mondial sur le Développement durable
L'UNESCO defend la diversité culturelle et l'éducation au Sommet Mondial sur le Développement durable Deputy Director-General to inaugurate Youth Tennis Tournament on July 8
Deputy Director-General to inaugurate Youth Tennis Tournament on July 8 Foro UNESCO sobre la crisis argentina
Foro UNESCO sobre la crisis argentina Dossier d'information sur l' Education pour tous - Le rôle de la societé civile
Dossier d'information sur l' Education pour tous - Le rôle de la societé civile  Qu'est-ce que l'UNESCO?
Qu'est-ce que l'UNESCO? La Conférence Générale a adopté la déclaration universelle sur la Diversité Culturelle
La Conférence Générale a adopté la déclaration universelle sur la Diversité Culturelle ONGs, Gobernancia y Desarollo en America Latina
ONGs, Gobernancia y Desarollo en America Latina Memória - Forum UNESCO-MERCOSUR
Memória - Forum UNESCO-MERCOSUR 24-25 mayo 2001 - Asunción
 La Diversidad Cultural ante la Mundialización Económica
La Diversidad Cultural ante la Mundialización Económica Re-penser les politiques culturelles
Re-penser les politiques culturelles "Démocratie et Gouvernance Mondiale au 21ème siècle"
"Démocratie et Gouvernance Mondiale au 21ème siècle"• The Real Existing Real Reality 2022
• Leçons de la « Grippe espagnole » de 1918-1919
• COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins UniversityDocuments
• En qué estábamos pensandoAnalyse
• La crise du COVID-19 : Pas de retour à la "normalité" du capitalisme !
• Borders Of An Epidemic - COVID-19 And Migrant WorkersAnalyse
• Rapport sur les Inégalités en Europe : L’harmonisation fiscale est la clé de la justice sociale Hors Presse
• Les mauvaises conditions de travail sont le principal problème mondial de l'emploi Hors Presse

| Partager | |||
 | |||
 | Google + |  | |
 | Messenger | Blogger | |
où trouver cet article :


 Actualités
Actualités







