

Pflichten ohne Grenzen
Source : Joseph S. Nye / Project Syndicate
CAMBRIDGE – Schätzungen zufolge sind im syrischen Bürgerkrieg mehr als 130.000 Menschen ums Leben gekommen. Die Berichte der Vereinten Nationen über Gräueltaten, Angriffe auf Zivilisten, deren Zeuge wir im Internet werden und die Aussagen von Flüchtlingen über erlittenes Leid sind herzzerreißend. Aber was ist zu tun – und von wem?
Unlängst hat der kanadische Wissenschaftler und Politiker Michael Ignatieff Präsident Obama eindringlich nahegelegt, eine Flugverbotszone über Syrien einzurichten, obwohl davon auszugehen ist, dass Russland sein Veto gegen eine entsprechende Resolution des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen einlegen würde, die notwendig ist, um ein solchen Schritt zu legitimieren. Wenn zugelassen wird, dass der syrische Präsident Baschar al-Assad weiter die Oberhand behält, so Ignatieff, werden seine Streitkräfte die verbleibenden sunnitischen Aufständischen auslöschen – zumindest fürs Erste. Ist der Hass neu geschürt, wird irgendwann wieder Blut fließen.
In einem anderen Beitrag hat der Kolumnist Thomas Friedman einige Lehren aus den jüngsten Erfahrungen der Vereinigten Staaten im Nahen Osten gezogen. Erstens verstehen Amerikaner kaum etwas von den komplexen gesellschaftlichen und politischen Gegebenheiten der dortigen Länder. Zweitens können die USA (mit erheblichem Aufwand) verhindern, dass schlimme Dinge geschehen, sie können aber nicht allein dafür sorgen, dass gute Dinge passieren. Und drittens, wenn Amerika versucht, gute Dinge in diesen Ländern zu verwirklichen, läuft es Gefahr die Verantwortung für die Lösung ihrer Probleme zu übernehmen.
Welche Pflichten hat also ein Staats- und Regierungschef über Grenzen hinweg? Das Problem geht weit über Syrien hinaus – derzeit häufen sich Berichte über Morde in Südsudan, der Zentralafrikanischen Republik, Somalia und anderen Orten. Die UN-Generalversammlung hat 2005 einstimmig eine «Schutzverantwortung» für Bevölkerungen beschlossen, wenn diese nicht von ihrer eigenen Regierung geschützt werden, und diese ist 2011 durch die Resolution 1973 des UN-Sicherheitsrates, mit der die Anwendung militärischer Gewalt in Libyen autorisiert wurde, zur Anwendung gelangt.
Russland, China und andere glauben, dass das Prinzip der Schutzverantwortung in Libyen missbraucht wurde und dass die UN-Charta die Leitdoktrin des Völkerrechts bleibt, die die Anwendung von Gewalt, außer zur Selbstverteidigung oder bei einer Autorisierung durch den Sicherheitsrat, verbietet. Doch 1999, als sich die NATO im Fall des Kosovo einem russischen Veto gegen eine potenzielle Resolution des Sicherheitsrates gegenüber sah, wendete sie trotzdem Gewalt an, und viele Verfechter argumentierten, dass die Entscheidung, von der Legitimität abgesehen, morallisch gerechtfertigt gewesen sei.
Welchen Argumenten sollten politische Führungskräfte folgen, wenn sie versuchen zu entscheiden, welche Politik die richtige ist? Die Antwort hängt, zum Teil, von der Gemeinschaft ab, der er oder sie sich moralisch verpflichtet fühlt.
Oberhalb der Ebene von Kleingruppen wird menschliche Identität durch das geprägt, was Benedict Anderson «vorgestellte Gemeinschaften» nennt. Wenige Menschen haben einen direkten Bezug zu den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft, mit der sie sich identifizieren. In den letzten Jahrhunderten war die Nation die vorgestellte Gemeinschaft, für die die meisten Menschen bereit waren, Opfer zu bringen und sogar zu sterben, und die meisten Staats- und Regierungschefs haben ihre vorrangige Verpflichtungen unter nationalem Gesichtspunkt betrachtet.
In einer globalisierten Welt gehören viele Menschen mehreren vorgestellten Gemeinschaften an. Einige – lokale, regionale, nationale, kosmopolitische – scheinen die Anordnung konzentrischer Kreise zu haben, wobei die Stärke der Identität mit zunehmender Entfernung zum Mittelpunkt abnimmt; aber in einem globalen Informationszeitalter ist diese Ordnung durcheinander geraten.
Heute sind viele Identitäten in sich überschneidenden Kreisen angeordnet – Geistesverwandtschaften, die durch das Internet und die Möglichkeit billig zu reisen aufrechterhalten werden. Diasporas sind heute nur einen Mausklick entfernt. Berufsgruppen halten länderübergreifende Standards ein. Aktivistengruppen, deren Spektrum von Umweltschützern bis zu Terroristen reicht, treten ebenfalls über Grenzen hinweg in Verbindung.
Infolgedessen ist Souveränität nicht mehr so uneingeschränkt und undurchdringlich wie es einst den Anschein hatte. Das ist die Realität, die die UN-Generalversammlung anerkannt hat, als sie die Verantwortung wahrgenommen hat, gefährdete Bevölkerungen in souveränen Staaten zu schützen.
Aber welche moralische Pflicht kommt damit einem einzelnen Regierungschef wie Obama zu? Die Führungstheoretikerin Barbara Kellerman hat dem ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton für seine unzureichende Reaktion auf den Völkermord in Ruanda 1994 moralisches Versagen durch Abschottung vorgeworfen. Andere Führer haben sich jedoch ebenfalls abgeschottet, und kein Land hat angemessen reagiert.
Hätte Clinton versucht amerikanische Truppen zu entsenden, wäre er auf heftigen Widerstand im US-Kongress gestoßen. Nachdem 1993 gerade erst US-Soldaten bei der humanitären Intervention in Somalia ums Leben gekommen waren, war die amerikanische Öffentlichkeit nicht in Stimmung für einen weiteren Militäreinsatz im Ausland.
Was also sollte ein demokratisch gewählter Führer in einer solchen Situation unternehmen? Clinton hat eingeräumt, dass er mehr dafür hätte tun können, die UN und andere Länder wachzurütteln, um in Ruanda Leben zu retten. Doch heutzutage stecken gute Führer oftmals in der Zwickmühle zwischen ihren persönlichen kosmopolitischen Neigungen und ihren traditionelleren Verpflichtungen gegenüber den Bürgern, die sie gewählt haben.
Glücklicherweise ist Abschottung keine moralische „Alles-oder-Nichts“-Aussage. In einer Welt, in der Menschen in nationalen Gemeinschaften organisiert sind, ist ein rein kosmopolitisches Ideal unrealistisch. Die Angleichung globaler Einkommen etwa ist keine glaubwürdige Pflicht für einen nationalen Spitzenpolitiker; dieser Politiker könnte jedoch Unterstützung hinter sich versammeln, indem er sagt, dass im weltweiten Kampf gegen Armut und Krankheit mehr getan werden sollte.
Der Philosoph Kwame Anthony Appiah hat es folgendermaßen ausgedrückt: „Du sollst nicht töten“ ist ein eindeutiges Gebot, das man einhält oder nicht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren lässt Abstufungen zu.
Das Gleiche gilt für Weltbürgertum versus Abschottung. Wir mögen politische Führer bewundern, die sich darum bemühen, den Sinn ihrer Anhänger für moralische Pflichten über Grenzen hinaus zu erweitern; es führt jedoch zu nichts, politischen Führungsköpfen einen unmöglichen Maßstab aufzuerlegen, der ihre Fähigkeit untergraben würde ihre Führungsrolle beizubehalten.
Während Obama mit der Entscheidung ringt, welche Verantwortung er in Syrien und anderswo hat, steht er vor einem ernsten moralischen Dilemma. Gemäß Appiah sind Verpflichtungen über Grenzen hinaus eine graduelle Angelegenheit. Und auch bei Interventionen gibt es Abstufungen, angefangen bei Flüchtlingshilfe über Waffen bis hin zu unterschiedlichen Maßen der Gewaltanwendung.
Doch sogar wenn derart abgestufte Entscheidungen getroffen werden, ist ein politischer Führer gegenüber seinen Anhängern auch zur Besonnenheit verpflichtet – die Besinnung auf den Eid des Hippokrates, vor allem nicht zu schaden. Ignatieff zufolge muss Obama ohnehin schon die Konsequenzen seiner Untätigkeit tragen; Friedman erinnert ihn an die Tugend der Besonnenheit. Obama ist nicht zu beneiden.
Aus dem Englischen von Sandra Pontow.


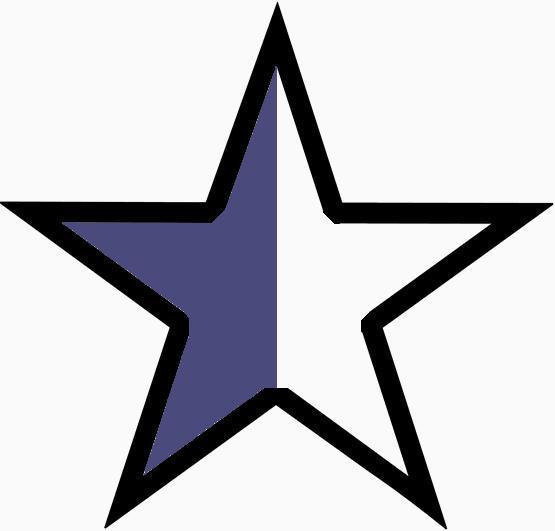
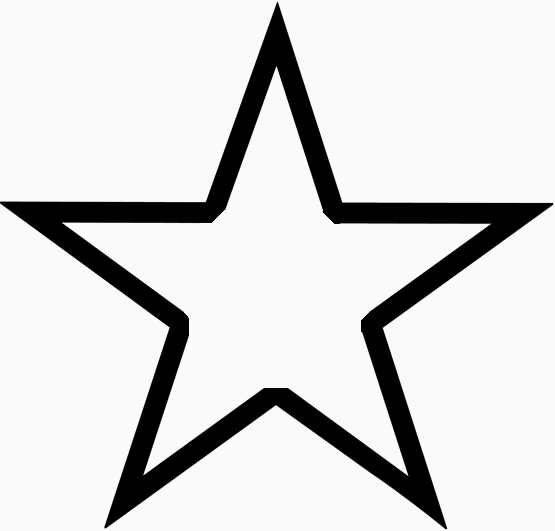


 Actualités
Actualités













